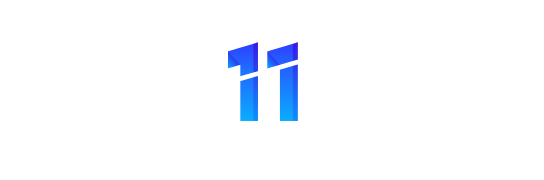In einem Staat, der sich selbst als „internationalistisch“ verstand, konnte ein einziger Eintrag in einem Formular das ganze Leben beeinflussen: die Nationalität. Sie war nicht nur ein Punkt auf dem Papier – sie war der „fünfte Punkt“, eine inoffizielle Grenze, die für viele unüberwindbar blieb.
Der sowjetische Pass und der „fünfte Punkt“
Der Inlandspass, ein verpflichtendes Dokument für alle Sowjetbürger, wurde erst 1974 flächendeckend eingeführt. Zuvor hatten nur Stadtbewohner (seit 1932) und später Arbeiter von Staatsgütern (ab 1953) Zugang. Kolchosbauern erhielten ihre Pässe als Letzte.
Ein markanter Unterschied zu den Ausweisen der Zarenzeit: Auf der fünften Zeile der sowjetischen Pässe stand die Nationalität. Genau dieser Eintrag wurde volkstümlich der „fünfte Punkt“ genannt.
Der unsichtbare Filter
In sowjetischen Formularen stand die Nationalität stets an fünfter Stelle. Doch ihre Bedeutung war alles andere als nebensächlich. Ob bei Bewerbungen für Universitäten, Stellen im Staatsdienst, in der Armee oder bei geheimdienstlichen Sicherheitsüberprüfungen – wer eine „unerwünschte“ Nationalität trug, stieß oft auf verschlossene Türen.
Vor allem Menschen mit jüdischem, deutschen, tatarischen, polnischen oder baltischen Hintergrund erlebten stille Diskriminierung. Ohne Erklärung, ohne offenen Widerspruch – einfach mit einem Ablehnungsbescheid. Das System war subtil und systematisch zugleich.
Keine Gesetze, aber klare Grenzen
Offiziell gab es kein Gesetz, das bestimmte Nationalitäten ausschloss. Doch de facto entstand eine Mauer, unsichtbar, aber mächtig. Berufsfelder wie Journalismus, Sicherheitsdienste, Militär oder wissenschaftliche Forschung waren für viele faktisch nicht zugänglich. Die Auswahlkriterien blieben im Dunkeln, die Folgen waren real: eingeschränkte Karrieren, verlorene Chancen, gebrochene Biografien.
Bis 1974 bestimmte die Nationalität des Vaters den Eintrag im Pass. Erst danach konnten Personen aus gemischten Familien bei der ersten Passausstellung frei wählen – aber nur einmal und nur zwischen Vater oder Mutter, laut offizieller Liste von 128 Nationalitäten.
– Aus der Praxis hat sich gezeigt, dass Bewerber mit „heiklen“ Einträgen oft nie eingeladen wurden – egal wie gut ihre Leistungen waren.
Der Preis der Herkunft
Der „fünfte Punkt“ war nicht nur eine Statistik. Er wurde zum Prüfstein für Vertrauen, Loyalität und Zugehörigkeit. Viele versuchten, ihre Herkunft zu verschleiern oder zu neutralisieren, indem sie etwa Namen änderten oder Nationalitäten der Eltern verschwieg.
Doch das System kannte seine Wege. In Akten von KGB und Innenministerium war der Eintrag fixiert. Einmal notiert, war er kaum zu tilgen. Selbst Kinder trugen die Herkunft ihrer Eltern weiter. Für viele bedeutete das: ein Leben in ständiger Rechtfertigung.
Heute: Erinnern statt Verdrängen
Was bleibt, ist die Verantwortung, sich dieser Geschichte zu stellen. Der „fünfte Punkt“ war mehr als nur ein Verwaltungsdetail – er war Ausdruck einer gesellschaftlichen Selektion, die im Stillen wirkte und doch Millionen traf.
Was denkst du dazu? Ist dir so ein „verdeckter Filter“ in anderen Kontexten begegnet?
PS: Wenn du einen Nachnamen hast, der als „anders“ galt – du bist nicht allein. Viele Familien tragen bis heute die Spuren dieser verborgenen Vergangenheit.
PPS: Lies auch unseren Beitrag: „Wie Namen Geschichte schreiben: Von Assimilation und Identitätsverlust“ – jetzt im Blog.