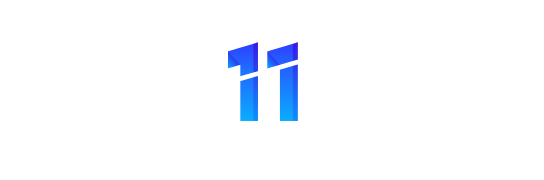Aber warum die Dschunke? Hier kamen die Händler doch mit Kamelen vorbei? „Wohl wegen der Investoren aus China“, vermutet Mokha Nasirova, die seit fünf Jahren Besucher durch ihre Heimatstadt führt. Und in der Tat wurde das Areal mit chinesischen Krediten teilfinanziert. Präsident Xi schaute höchstpersönlich vorbei, als im vergangenen September das Gipfeltreffen der „Shanghai Cooperation Organisation“ stattfand, einem Zusammenschluss Chinas mit Russland und anderen süd- und zentralasiatischen Staaten.
 „Die Welt trifft sich in Samarkand aber schon seit Langem“, meint Mokha und zeigt mit Stolz auf die berühmten Afrosiab-Wandmalereien. 1965 hatten Forscher die Bilderfragmente entdeckt, als sie einen Fürstenpalast aus dem 7. Jahrhundert ausgruben. Vermutlich schmückten die Szenen die Audienzhalle. Eine orientalische Prinzessin auf einem Elefanten ist zu sehen, gefolgt von Händlern und Kriegern auf Kamelen und Pferden. Selbst der Kaiser von China ist dargestellt, samt Gattin im Boot. Die beiden waren zwar nicht in Samarkand, schickten aber Gesandte mit Seidenstoffen und Kokonbüschel. Auch das ist gut sichtbar erhalten. Noch erstaunlicher sind die Blautöne, die auch nach 1400 Jahren ziemlich frisch wirken.
„Die Welt trifft sich in Samarkand aber schon seit Langem“, meint Mokha und zeigt mit Stolz auf die berühmten Afrosiab-Wandmalereien. 1965 hatten Forscher die Bilderfragmente entdeckt, als sie einen Fürstenpalast aus dem 7. Jahrhundert ausgruben. Vermutlich schmückten die Szenen die Audienzhalle. Eine orientalische Prinzessin auf einem Elefanten ist zu sehen, gefolgt von Händlern und Kriegern auf Kamelen und Pferden. Selbst der Kaiser von China ist dargestellt, samt Gattin im Boot. Die beiden waren zwar nicht in Samarkand, schickten aber Gesandte mit Seidenstoffen und Kokonbüschel. Auch das ist gut sichtbar erhalten. Noch erstaunlicher sind die Blautöne, die auch nach 1400 Jahren ziemlich frisch wirken.
Begehrtes Ziel für Einheimische
Überhaupt dieses Blau! Man kann ihm in Samarkand kaum entrinnen. Blau sind die Kuppeln von Moscheen und Mausoleen, Marineblau und Türkis schillern die prächtigen Fassaden der Medresen. Gleich drei dieser islamischen Hochschulen flankieren den berühmten Registan, wie der einstige Hauptplatz heißt. Doch gelehrt wird darin schon lange nicht mehr, sondern eher gefeilscht: „Schauen Sie rein!“, rufen sie abwechselnd auf Englisch, Usbekisch und Russisch, um die Touristen in einen der vielen Läden zu locken. Wo sich einst islamische Gelehrte und Schüler über Bücher beugten, stapeln sich heute Kunst und Krempel. Pudelmützen, Mäntelchen und Plastikkrönchen liegen bereit, damit sich Touristen zur Fotosession in Schale schmeißen können. Großfamilien und Schülergruppen schlendern über den Platz, auch bei Einheimischen steht Samarkand hoch im Kurs. Die Seidenstraßenstadt ist gut zu erreichen: Von Taschkent etwa braucht der Schnellzug gerade mal zwei Stunden.
Samarkand ist die Nummer eins im Usbekistan-Tourismus, und der soll kräftig ausgebaut werden. In den drei Jahren vor der Pandemie stieg die Zahl der internationalen Besucher rapide von 2,7 auf 6,8 Millionen. Bis 2026 sollen es 9 Millionen sein. Das sind auch gute Nachrichten für die 35-jährige Mokha, die in der Hauptsaison als Guide arbeitet und abends jungen Studenten Englisch beibringt. „Der Tourismus hat mein Leben total umgekrempelt“, erzählt die zweifache Mutter, die 2007 erstmals auf ausländische Touristen traf. Damals, als das einst zur Sowjetunion gehörige Land von Präsident Karimov mit eiserner Hand regiert wurde, verirrten sich nur wenige Besucher hierher. Aufgewachsen in einer traditionell muslimischen Familie, war Mokhas Weg eigentlich vorgezeichnet: 2009 arrangierte Heirat, dann die Kinder, ihr Mann wollte sie zu Hause halten.
 Doch sie hatte ihre eigenen Vorstellungen, machte ihre Reiseleiterlizenz und begann Touristen herumzuführen. Jetzt verdient sie deutlich mehr als ihr Gatte und fühlt sich endlich respektiert. „Die Alten erzählen den Jungen, was sie tun sollen? Diese Zeiten sind vorbei. Wir wollen selbst entscheiden“, meint sie mit Bestimmtheit und fühlt sich von hoher Stelle bestätigt: „Schon Ulugh Beg hat betont, dass auch Frauen Recht auf Bildung haben“, erklärt sie. Der große Gelehrte des 15. Jahrhunderts ist so etwas wie der Galilei von Usbekistan, seine mathematischen und astronomischen Berechnungen waren seiner Zeit voraus. Ihm wird der Satz zugeschrieben: „Das Streben nach Wissen ist die Pflicht jedes Muslims und jeder Muslimin.“ Reste eines Observatoriums und eine Medrese auf dem Registan erinnern an ihn.
Doch sie hatte ihre eigenen Vorstellungen, machte ihre Reiseleiterlizenz und begann Touristen herumzuführen. Jetzt verdient sie deutlich mehr als ihr Gatte und fühlt sich endlich respektiert. „Die Alten erzählen den Jungen, was sie tun sollen? Diese Zeiten sind vorbei. Wir wollen selbst entscheiden“, meint sie mit Bestimmtheit und fühlt sich von hoher Stelle bestätigt: „Schon Ulugh Beg hat betont, dass auch Frauen Recht auf Bildung haben“, erklärt sie. Der große Gelehrte des 15. Jahrhunderts ist so etwas wie der Galilei von Usbekistan, seine mathematischen und astronomischen Berechnungen waren seiner Zeit voraus. Ihm wird der Satz zugeschrieben: „Das Streben nach Wissen ist die Pflicht jedes Muslims und jeder Muslimin.“ Reste eines Observatoriums und eine Medrese auf dem Registan erinnern an ihn.
Auch Kutbija Rafiewa war ihrer Zeit immer ein wenig voraus. Als Deutsch-Studentin schrieb sie in der Sowjetzeit ihre Diplomarbeit über Hans Falladas Roman „Jeder stirbt für sich allein“, 1997 eröffnete sie mit ihrer Schwester das Antica-Restaurant und baute es später zu einem hübschen Boutiquehotel aus. Schon lange engagiert sich die Sechzigjährige für die Stadterhaltung.
 „Siehst du die Mauer um unser Viertel? Die hat die Regierung 2009 errichtet, damit die Besucher des nahen Timur-Mausoleums nicht das wirkliche Leben sehen müssen“, erzählt sie und beklagt den Erneuerungswahn: „Viel alte Bausubstanz wurde zerstört, vielerorts werden Alteingesessene verdrängt.“ Heute wenigstens können sie sich wehren. So wurden Pläne, den von alten Bäumen gesäumten, 150-jährigen Universitätsboulevard auszubauen, nach Protesten gestoppt.
„Siehst du die Mauer um unser Viertel? Die hat die Regierung 2009 errichtet, damit die Besucher des nahen Timur-Mausoleums nicht das wirkliche Leben sehen müssen“, erzählt sie und beklagt den Erneuerungswahn: „Viel alte Bausubstanz wurde zerstört, vielerorts werden Alteingesessene verdrängt.“ Heute wenigstens können sie sich wehren. So wurden Pläne, den von alten Bäumen gesäumten, 150-jährigen Universitätsboulevard auszubauen, nach Protesten gestoppt.
„Für uns Frauen hat der Tourismus auch viel Gutes gebracht“, betont Kutbija: „Schau dir die vielen Homestays und Gästehäuser an. Sie werden fast alle von Frauen geführt und sind oft nach ihnen benannt: Durdona, Barno, Mokhina – schöne, wohlklingende Namen! Wir alle tragen unseren Teil dazu bei, die Authentizität Samarkands zu bewahren.“ Die irregeleitete Chinesendschunke wurde vermutlich von Männern geplant.